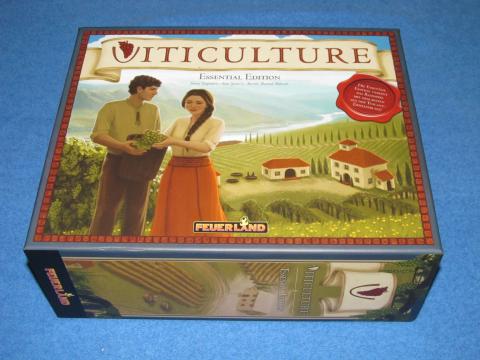
Viticulture
Weinbau in der Toskana, man will sein Weingut zum Erfolg führen. Man teilt Arbeiter im Jahresverlauf ein, sie haben verschiedene Aufgaben je nach Jahreszeit; es gibt Wettbewerb um diese Aufgaben und wer sie zuerst erledigen kann, hat einen Vorteil. Touristen lassen sich als Helfer einsetzen, müssen aber von einem Arbeiter beaufsichtigt werden. Man baut Gebäude, pflanzt Weinstöcke und erledigt Bestellungen. Die Regeln dieser Ausgabe wurden gegenüber Viticulture überarbeitet, zum Material aus Viticulture kommen einige Elemente aus dem Spiel Toskana hinzu und es gibt eine Solo-Variante namens Automa.
Dieses Spiel ist in folgenden Sprachen veröffentlicht:
DeutschLudografische Angaben
Verlage:
Redaktion:
Illustratoren:
Inventarnummer:
26567
Tags:
nbg16
Kategorien:
Kooperativ, Experten, komplex, Worker /Würfel Placement, Aufträge / Verträge / Missionen, Weinbau, Weingut
Rezension
Viticulture Essential Edition
Unsere Rezension
Wundervolle
Weinfarbenlehre sowie Wetterverschiebungen
Viticulture
Essential Edition
Wollen wir wieder
Worker-Placement?
Wien und der Wein, eine jahrhundertelange
bekannt-bewährte Verbindung; zum Thema Brettspiel und Wein fällt zunächst
einmal „Vino“ (Goldsieber 1999) ein, in den Jahren danach hat es vorerst mit
„Die Weinhändler“ nur zwei Spiele (mit sogar gleichem Titel) gegeben (Piatnik
2000 und Amigo 2004). Nach einer längeren Pause sind im Spieleherbst 2010 dann
gleich vier Wirtschaftsspiele zum Thema Weinbau erschienen: „Grand Cru“
(eggertspiele), „King´s Vineyard“ (Mayday Games), „Toscana“ (Aqua Games) und
„Vinhos“ (Huch & friends – heuer mit geplanter Neuauflage in einer Deluxe
Edition); das Jahr darauf hat dann auch noch „Vintage“ gesehen. „Viticulture“
liegt bereits seit 2013 als erfolgreiches Kickstarter-Projekt vor, nunmehr hat
es eine (etwas veränderte bzw. verbesserte) Neuauflage beim Feuerland-Verlag
erfahren (beinhaltend bereits Elemente aus der sogenannten
„Tuscany“-Erweiterung).
Thema ist weiterhin der Weinbau in der Toskana: Und dem
Spiel eilt der Ruf voraus, sich gerade in seiner thematischen Umsetzung besonders
hervorzuheben. Nun ja; nicht nur werden hier (erst) im Sommer die Reben
gepflanzt und die Trauben (nicht im Herbst, sondern) im Winter gelesen (oder
ist das bereits ein Tribut an den Klimawandel)? Auch gestaltet sich das Keltern
von Rosé-Wein eher „originell“, nämlich aus einer Mischung aus dem Most von
roten und weißen Trauben. Aber Stadtkindern, die glauben, dass die Milch von
lila Kühen stammt, kann man ja ohnehin alles erzählen. In diesem Sinne ist wohl
auch der ungewollt komische, dafür gleich dreimal in der Spielanleitung zu
findende Hinweis zu verstehen: „Die Rebenkarten verbleiben nach der Ernte auf
dem Gebiet. Winzer belassen die Reben im Boden, wenn sie Trauben ernten. Du
pflückst lediglich die Trauben von den Reben“. Und auch die Herstellung von
Sekt mutet eher eigenwillig an. Letztlich lässt sich auch der Umstand, dass
geerntete Trauben bei längerer Lagerung stetig wertvoller werden, nur anhand
der spielerischen Notwendigkeit begründen.
Aber (jedenfalls vorerst ;) genug genörgelt; das Spielmaterial
muss man sich nämlich wirklich nicht erst „schöntrinken“: Zum einen begeistern
die detailliert gestalteten kleinen Holzspielsteine; u.a. Hähne für die
Zugreihenfolge pro Runde, eine klassische Weintraube für den Startspieler,
Weinflaschen als Anzeige für das Einkommen und diverse niedliche Bauwerke
(sogar die beiden Weinkeller pro Mitspieler sind unterschiedlich gestaltet).
Zum anderen gibt es 76 völlig unterschiedlich gezeichnete und benannte
Besucherkarten (auch in ihrer Funktion ähnlich wie die Ausbildungen bei
„Agricola“).
Eine Partie ist relativ flott aufgebaut, wobei jeder
Mitspieler etwas unterschiedliche Startvoraussetzungen erhält (entzückend
dargestellt über jeweils eine „Mama“- und eine „Papa“-Karte, die quasi das
jeweilige Startkapital vererben). Stets mit dabei sind jedenfalls zwei kleine
und ein großer Arbeiter (weitere können im Spielverlauf eingestellt werden).
Die Arbeiter werden natürlich (wie auch sonst immer) auf die bekannt-bewährten
Einsetzfelder auf dem Spielplan platziert, um dem Besitzer sofort einen
(hoffentlich) sinnvollen Vorteil zu verschaffen. Da jedes Feld nur einmal pro
Runde genutzt werden darf, dient der große Arbeiter dazu, sich nachträglich
noch die Funktion eines Aktionsbereiches zu sichern. Eine gute und (sogar) neue
Idee ist die Unterteilung der Einsetzfelder in einen Sommer- und Winter-Bereich
(unverständlicher Weise aber leider nicht in einen Frühlings- und
Herbst-Bereich):
Die Arbeiter dürfen nämlich nicht gleich auf dem ganzen
Spielplan eingesetzt werden, zunächst kommt der „Sommer“ dran; erst wenn alle
in dieser Phase gepasst haben, folgt der „Winter“. Man muss sich also neben der
permanenten Frage, wo setze ich gleich einen Arbeiter hin, wo kann ich mir
vielleicht noch Zeit lassen, auch noch überlegen, wie viele Arbeiter man für
die Einsetzfelder des „Winters“ aufheben soll bzw. will. Weniger neu, dafür
ebenfalls gut ist ein Bonus, den üblicherweise der erste Arbeiter pro
Aktionsbereich lukriert; auch das macht die wiederholten Entscheidungen
hinsichtlich des Einsetzortes und des Timings knifflig und spannend. Die
Auswahl eines Wunsch-Bonus (soweit für den Einzelnen noch möglich) spielt auch
zu Beginn jeder Runde eine große Rolle, wenn die Mitspieler ihre jeweiligen
Hähne auf der Zugreihenfolgeleiste platzieren: Ein früheres Drankommen bedeutet
hier nämlich die Zuteilung eines schwächeren Bonus als für die Mitspieler, die
sich erst später von ihren Hähnen wecken lassen wollen.
Was „Viticulture“ über sonstige Worker-Placement-Spiele
hervorzuheben vermag, ist die Möglichkeit der Verwendung von sogenannten
„Besucherkarten“. Diese gewähren dem jeweils Ausspielenden nämlich einen
einmaligen und jeweils einzigartigen Vorteil (wobei für das Nutzen zuvor oft
auch eine Bedingung vorhanden sein oder etwas Bestimmtes abgegeben werden
muss). Die Motivation zur optimalen Kombination aufgrund des chronologisch
„richtigen“ Ausspielens dieser Karten bewirkt jedenfalls einen sehr hohen
Spielreiz. Verstärkt wird dieser noch dadurch, als die Karten nicht einfach so
gespielt werden dürfen, sondern erst nach dem Einsetzen eines Arbeiters auf dem
entsprechenden Feld (wobei der Erste gleich zwei Karten nutzen darf). Damit
verbunden ist zwar ein gewisser Glücksanteil beim Nachziehen dieser Karten,
zumal deren Funktionen manchmal nicht ausgewogen bzw. unterschiedlich „stark“
erscheinen. Doch ist dies wohl eher dem Umstand zuzuschreiben, dass es beim
(vermeintlich) starken oder schwachen Effekt der jeweiligen Wirkung vor allem
auf die gerade gegebene allgemeine und persönliche Spielsituation ankommt. Die
Kunst liegt immer wieder eben darin, eine Spielsituation zu schaffen, in
welcher der Effekt der jeweiligen Karte besonders zum Tragen kommt.
Aber auch die anderen beiden Kartentypen sorgen für
Spannung (bzw. für Freude und/oder Frust) und verstärken den spielerischen
Glücksanteil: Zum einen die Rebenkarten; nachdem diese zufällig gezogen und
später auf dem eigenen Tableau „gepflanzt“ worden sind, lassen sich mit diesen
rote und/oder weiße Trauben lesen bzw. ernten. Schön also, wenn ich eine weiße
Rebensorte als Ergänzung zu meinen bereits gepflanzten roten Reben nachziehe;
weniger schön, wenn ich stets nur rote Reben ziehe. Schön, wenn ich Rebensorte
nachziehe, die gut zu meinen bereits errichteten Bauwerken passen (dazu stehen
„Spalier“ und/oder „Bewässerung“ zur Verfügung); weniger schön, wenn ich wegen
der neuen Rebenkarte vielleicht erst extra noch ein weiteres Bauwerk errichten
muss. Aber auch hier ist der Reiz hoch, entweder schon im Vorhinein allgemein
tauglichere Voraussetzungen zu schaffen, oder eben das Beste aus den neu
gezogenen Karten zu machen.
Zum anderen haben diese Überlegungen auch für die
Weinbestellungen Gültigkeit; dabei handelt es sich um Auftragskarten, mit denen
man für Rot- und/oder Weiß- und/oder Rosé-Wein und/oder Sekt Siegpunkte und
Einkommen erhält. Schön, wenn man etwa eine Karte zieht, die zwei Weine
fordert, welche bereits in den eigenen Kellern lagern. Weniger schön, wenn ich
eine Weinbestellung erhalte, für die etwa ein erst mühsam herzustellender Sekt erforderlich
wäre, obgleich ich mich mit meiner Produktion eigentlich lieber mit billigen
Massenweinen begnügen wollte (weil ich mir dabei das teure Ausbauen meines
Kellers ersparen würde). Aber auch manche der Besucherkarten gewähren
Siegpunkte, im Ergebnis oft sogar mehr als die Mitspieler erwarten würden (und
jedenfalls zu deren Überraschung).
„Viticulture“ spielt sich zwar in jeder Besetzung
gleichermaßen gut, bei mehr Mitspielern dauert eine Partie aber länger. Ab drei
Mitspielern gibt es zwei Einsetzfelder pro Aktion, ab fünf Mitspielern sogar
drei, was eine elegante und unkomplizierte Anpassung der Mechanik an die
Spielerzahl darstellt. Und sogar eine Solo-Variante (mit einer nur ca.
halbstündigen Dauer) ist enthalten: Dabei wird ein Spiel zu zweit simuliert,
wobei zufällig gezogene „Automa-Karten“ festlegen, welche (null bis drei)
Einsetzfelder der aktuellen Jahreszeit bereits vom „Mitspieler“ besetzt (und
somit blockiert) sind; weiters werden für den Einzelspieler auch noch ein
Kampagnen-Modus sowie fünf Schwierigkeitsstufen angeboten. Damit einher geht
aber (wieder einmal) das bekannte Manko wie bei so vielen anderen
Worker-Placement-Spielen: Im Wesentlichen spielen nämlich alle parallel
nebeneinander her. Zwar gibt es natürlich Interaktion über das „Wegschnappen“
von Einsetzfeldern, doch ist das zumeist eher eine zufällige als eine gewollte
Konsequenz der jeweiligen Spielweise. Immerhin haben noch manche der (selbst
ausgespielten) Besucherkarten Einfluss auch auf die Mitspieler; wer jedoch
Worker-Placement-Spiele mit viel Interaktion bevorzugt, sollte doch besser
„Keyflower“ (WIN 448 vom Februar 2013) und/oder „Spyrium“ (WIN 462 vom Februar
2014) spielen.
Und was am grundsätzlich sehr tollen Spielmaterial doch
noch zu kritisieren bleibt, sind zum einen die etwas übertrieben klein
geratenen Texte auf den Besucherkarten. Zum anderen verursacht nicht nur die
Farbwahl (von blau und lila) immer wieder das eine oder andere Missverständnis,
auch die Holzfiguren „Cottage“ und „Keller“ (sowie die entsprechende grafische
Gestaltung auf den „Papa“-Karten) bergen Verwechslungspotential. Zwar sind auch
die Bauwerke detailliert gestaltet, doch würde man sich bei einem Spiel in
diesem Preissegment auch bei diesen Spielsteinen größere Exemplare erwarten.
Und da ohnehin bereits der Spielplan und die Spielertableaus zweisprachig
ausgefallen sind, wäre es wohl auch angebracht gewesen, die 76 Besucherkarten
in ihrer englischen Variante mit in die Schachtel hineinzupacken. Ein
allerletztes Mal soll auch noch die wirklich unsinnige und thematisch störende
Unterteilung der Einsetzfelder in einen Sommer- und einen Winter-Bereich
(anstatt in einen Frühlings- und einen Herbstbereich) moniert werden.
Harald Schatzl
Spieler: 1-6
Alter: 12+
Dauer: 90+
Autoren: Jamey Stegmaier
& Alan Stone
+ Morten Monrad Pedersen
Grafik: Christine Santana
Preis: ca. 60 Euro
Verlag: Feuerland Spiele 2016
Web: www.feuerland-spiele.de
Genre: Worker Placement
Zielgruppe: Experten
Spezial: 1 Spieler
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja
Kommentar:
schöne und stimmungsvolle grafische Gestaltung
hohe Qualität des Spielmaterials
variable Rundenanzahl und
spielerzahlabhängige Spieldauer
sehr gut (auch) zu zweit sowie solo spielbar
in Begleitung von Vielspielern auch für Gelegenheitsspieler
geeignet
Vergleichbar:
Agricola; Lewis & Clark
Andere Ausgaben:
Viticulture, Stonemaier Games
Meine Einschätzung: 6
Harald Schatzl:
Optisch überzeugt „Viticulture“ gleich nach dem Öffnen mit
seinem strahlenden Spielmaterial, auch wenn sich nach Luftzufuhr eine etwas
ungeschickte Farbwahl mit Verwechslungsrisiken (selbst im noch nüchternen
Zustand) zeigt. Der erste Schluck wirkt aufgrund der erdig-klassischen
Spielmechanismen zwar noch eher neutral, am Gaumen überzeugt dann aber die
betont spielerische Note. Hervorzuheben ist der lang anhaltende Abgang bedingt
durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Karten und der Möglichkeit des Ausprobierens
unterschiedlicher Spielweisen; dies bei einer ausgereiften, dennoch nicht zu
übertriebenen Komplexität. Insgesamt jedenfalls eine äußerst befriedigende
Geschmacksfülle mit einer nahezu perfekt harmonisierenden Balance aus Bewährtem
und dem fein eingebundenen Thema, die im Detail mit runder Eleganz zu punkten
vermag.
Zufall (rosa): 2
Taktik (türkis): 3
Strategie (blau): 2
Kreativität (dunkelblau): 0
Wissen (gelb): 0
Gedächtnis (orange): 0
Kommunikation (rot): 0
Interaktion (braun): 1
Geschicklichkeit (grün): 0
Action (dunkelgrün): 0
Unsere Rezension
Wundervolle
Weinfarbenlehre sowie Wetterverschiebungen
Viticulture
Essential Edition
Wollen wir wieder
Worker-Placement?
Wien und der Wein, eine jahrhundertelange
bekannt-bewährte Verbindung; zum Thema Brettspiel und Wein fällt zunächst
einmal „Vino“ (Goldsieber 1999) ein, in den Jahren danach hat es vorerst mit
„Die Weinhändler“ nur zwei Spiele (mit sogar gleichem Titel) gegeben (Piatnik
2000 und Amigo 2004). Nach einer längeren Pause sind im Spieleherbst 2010 dann
gleich vier Wirtschaftsspiele zum Thema Weinbau erschienen: „Grand Cru“
(eggertspiele), „King´s Vineyard“ (Mayday Games), „Toscana“ (Aqua Games) und
„Vinhos“ (Huch & friends – heuer mit geplanter Neuauflage in einer Deluxe
Edition); das Jahr darauf hat dann auch noch „Vintage“ gesehen. „Viticulture“
liegt bereits seit 2013 als erfolgreiches Kickstarter-Projekt vor, nunmehr hat
es eine (etwas veränderte bzw. verbesserte) Neuauflage beim Feuerland-Verlag
erfahren (beinhaltend bereits Elemente aus der sogenannten
„Tuscany“-Erweiterung).
Thema ist weiterhin der Weinbau in der Toskana: Und dem
Spiel eilt der Ruf voraus, sich gerade in seiner thematischen Umsetzung besonders
hervorzuheben. Nun ja; nicht nur werden hier (erst) im Sommer die Reben
gepflanzt und die Trauben (nicht im Herbst, sondern) im Winter gelesen (oder
ist das bereits ein Tribut an den Klimawandel)? Auch gestaltet sich das Keltern
von Rosé-Wein eher „originell“, nämlich aus einer Mischung aus dem Most von
roten und weißen Trauben. Aber Stadtkindern, die glauben, dass die Milch von
lila Kühen stammt, kann man ja ohnehin alles erzählen. In diesem Sinne ist wohl
auch der ungewollt komische, dafür gleich dreimal in der Spielanleitung zu
findende Hinweis zu verstehen: „Die Rebenkarten verbleiben nach der Ernte auf
dem Gebiet. Winzer belassen die Reben im Boden, wenn sie Trauben ernten. Du
pflückst lediglich die Trauben von den Reben“. Und auch die Herstellung von
Sekt mutet eher eigenwillig an. Letztlich lässt sich auch der Umstand, dass
geerntete Trauben bei längerer Lagerung stetig wertvoller werden, nur anhand
der spielerischen Notwendigkeit begründen.
Aber (jedenfalls vorerst ;) genug genörgelt; das Spielmaterial
muss man sich nämlich wirklich nicht erst „schöntrinken“: Zum einen begeistern
die detailliert gestalteten kleinen Holzspielsteine; u.a. Hähne für die
Zugreihenfolge pro Runde, eine klassische Weintraube für den Startspieler,
Weinflaschen als Anzeige für das Einkommen und diverse niedliche Bauwerke
(sogar die beiden Weinkeller pro Mitspieler sind unterschiedlich gestaltet).
Zum anderen gibt es 76 völlig unterschiedlich gezeichnete und benannte
Besucherkarten (auch in ihrer Funktion ähnlich wie die Ausbildungen bei
„Agricola“).
Eine Partie ist relativ flott aufgebaut, wobei jeder
Mitspieler etwas unterschiedliche Startvoraussetzungen erhält (entzückend
dargestellt über jeweils eine „Mama“- und eine „Papa“-Karte, die quasi das
jeweilige Startkapital vererben). Stets mit dabei sind jedenfalls zwei kleine
und ein großer Arbeiter (weitere können im Spielverlauf eingestellt werden).
Die Arbeiter werden natürlich (wie auch sonst immer) auf die bekannt-bewährten
Einsetzfelder auf dem Spielplan platziert, um dem Besitzer sofort einen
(hoffentlich) sinnvollen Vorteil zu verschaffen. Da jedes Feld nur einmal pro
Runde genutzt werden darf, dient der große Arbeiter dazu, sich nachträglich
noch die Funktion eines Aktionsbereiches zu sichern. Eine gute und (sogar) neue
Idee ist die Unterteilung der Einsetzfelder in einen Sommer- und Winter-Bereich
(unverständlicher Weise aber leider nicht in einen Frühlings- und
Herbst-Bereich):
Die Arbeiter dürfen nämlich nicht gleich auf dem ganzen
Spielplan eingesetzt werden, zunächst kommt der „Sommer“ dran; erst wenn alle
in dieser Phase gepasst haben, folgt der „Winter“. Man muss sich also neben der
permanenten Frage, wo setze ich gleich einen Arbeiter hin, wo kann ich mir
vielleicht noch Zeit lassen, auch noch überlegen, wie viele Arbeiter man für
die Einsetzfelder des „Winters“ aufheben soll bzw. will. Weniger neu, dafür
ebenfalls gut ist ein Bonus, den üblicherweise der erste Arbeiter pro
Aktionsbereich lukriert; auch das macht die wiederholten Entscheidungen
hinsichtlich des Einsetzortes und des Timings knifflig und spannend. Die
Auswahl eines Wunsch-Bonus (soweit für den Einzelnen noch möglich) spielt auch
zu Beginn jeder Runde eine große Rolle, wenn die Mitspieler ihre jeweiligen
Hähne auf der Zugreihenfolgeleiste platzieren: Ein früheres Drankommen bedeutet
hier nämlich die Zuteilung eines schwächeren Bonus als für die Mitspieler, die
sich erst später von ihren Hähnen wecken lassen wollen.
Was „Viticulture“ über sonstige Worker-Placement-Spiele
hervorzuheben vermag, ist die Möglichkeit der Verwendung von sogenannten
„Besucherkarten“. Diese gewähren dem jeweils Ausspielenden nämlich einen
einmaligen und jeweils einzigartigen Vorteil (wobei für das Nutzen zuvor oft
auch eine Bedingung vorhanden sein oder etwas Bestimmtes abgegeben werden
muss). Die Motivation zur optimalen Kombination aufgrund des chronologisch
„richtigen“ Ausspielens dieser Karten bewirkt jedenfalls einen sehr hohen
Spielreiz. Verstärkt wird dieser noch dadurch, als die Karten nicht einfach so
gespielt werden dürfen, sondern erst nach dem Einsetzen eines Arbeiters auf dem
entsprechenden Feld (wobei der Erste gleich zwei Karten nutzen darf). Damit
verbunden ist zwar ein gewisser Glücksanteil beim Nachziehen dieser Karten,
zumal deren Funktionen manchmal nicht ausgewogen bzw. unterschiedlich „stark“
erscheinen. Doch ist dies wohl eher dem Umstand zuzuschreiben, dass es beim
(vermeintlich) starken oder schwachen Effekt der jeweiligen Wirkung vor allem
auf die gerade gegebene allgemeine und persönliche Spielsituation ankommt. Die
Kunst liegt immer wieder eben darin, eine Spielsituation zu schaffen, in
welcher der Effekt der jeweiligen Karte besonders zum Tragen kommt.
Aber auch die anderen beiden Kartentypen sorgen für
Spannung (bzw. für Freude und/oder Frust) und verstärken den spielerischen
Glücksanteil: Zum einen die Rebenkarten; nachdem diese zufällig gezogen und
später auf dem eigenen Tableau „gepflanzt“ worden sind, lassen sich mit diesen
rote und/oder weiße Trauben lesen bzw. ernten. Schön also, wenn ich eine weiße
Rebensorte als Ergänzung zu meinen bereits gepflanzten roten Reben nachziehe;
weniger schön, wenn ich stets nur rote Reben ziehe. Schön, wenn ich Rebensorte
nachziehe, die gut zu meinen bereits errichteten Bauwerken passen (dazu stehen
„Spalier“ und/oder „Bewässerung“ zur Verfügung); weniger schön, wenn ich wegen
der neuen Rebenkarte vielleicht erst extra noch ein weiteres Bauwerk errichten
muss. Aber auch hier ist der Reiz hoch, entweder schon im Vorhinein allgemein
tauglichere Voraussetzungen zu schaffen, oder eben das Beste aus den neu
gezogenen Karten zu machen.
Zum anderen haben diese Überlegungen auch für die
Weinbestellungen Gültigkeit; dabei handelt es sich um Auftragskarten, mit denen
man für Rot- und/oder Weiß- und/oder Rosé-Wein und/oder Sekt Siegpunkte und
Einkommen erhält. Schön, wenn man etwa eine Karte zieht, die zwei Weine
fordert, welche bereits in den eigenen Kellern lagern. Weniger schön, wenn ich
eine Weinbestellung erhalte, für die etwa ein erst mühsam herzustellender Sekt erforderlich
wäre, obgleich ich mich mit meiner Produktion eigentlich lieber mit billigen
Massenweinen begnügen wollte (weil ich mir dabei das teure Ausbauen meines
Kellers ersparen würde). Aber auch manche der Besucherkarten gewähren
Siegpunkte, im Ergebnis oft sogar mehr als die Mitspieler erwarten würden (und
jedenfalls zu deren Überraschung).
„Viticulture“ spielt sich zwar in jeder Besetzung
gleichermaßen gut, bei mehr Mitspielern dauert eine Partie aber länger. Ab drei
Mitspielern gibt es zwei Einsetzfelder pro Aktion, ab fünf Mitspielern sogar
drei, was eine elegante und unkomplizierte Anpassung der Mechanik an die
Spielerzahl darstellt. Und sogar eine Solo-Variante (mit einer nur ca.
halbstündigen Dauer) ist enthalten: Dabei wird ein Spiel zu zweit simuliert,
wobei zufällig gezogene „Automa-Karten“ festlegen, welche (null bis drei)
Einsetzfelder der aktuellen Jahreszeit bereits vom „Mitspieler“ besetzt (und
somit blockiert) sind; weiters werden für den Einzelspieler auch noch ein
Kampagnen-Modus sowie fünf Schwierigkeitsstufen angeboten. Damit einher geht
aber (wieder einmal) das bekannte Manko wie bei so vielen anderen
Worker-Placement-Spielen: Im Wesentlichen spielen nämlich alle parallel
nebeneinander her. Zwar gibt es natürlich Interaktion über das „Wegschnappen“
von Einsetzfeldern, doch ist das zumeist eher eine zufällige als eine gewollte
Konsequenz der jeweiligen Spielweise. Immerhin haben noch manche der (selbst
ausgespielten) Besucherkarten Einfluss auch auf die Mitspieler; wer jedoch
Worker-Placement-Spiele mit viel Interaktion bevorzugt, sollte doch besser
„Keyflower“ (WIN 448 vom Februar 2013) und/oder „Spyrium“ (WIN 462 vom Februar
2014) spielen.
Und was am grundsätzlich sehr tollen Spielmaterial doch
noch zu kritisieren bleibt, sind zum einen die etwas übertrieben klein
geratenen Texte auf den Besucherkarten. Zum anderen verursacht nicht nur die
Farbwahl (von blau und lila) immer wieder das eine oder andere Missverständnis,
auch die Holzfiguren „Cottage“ und „Keller“ (sowie die entsprechende grafische
Gestaltung auf den „Papa“-Karten) bergen Verwechslungspotential. Zwar sind auch
die Bauwerke detailliert gestaltet, doch würde man sich bei einem Spiel in
diesem Preissegment auch bei diesen Spielsteinen größere Exemplare erwarten.
Und da ohnehin bereits der Spielplan und die Spielertableaus zweisprachig
ausgefallen sind, wäre es wohl auch angebracht gewesen, die 76 Besucherkarten
in ihrer englischen Variante mit in die Schachtel hineinzupacken. Ein
allerletztes Mal soll auch noch die wirklich unsinnige und thematisch störende
Unterteilung der Einsetzfelder in einen Sommer- und einen Winter-Bereich
(anstatt in einen Frühlings- und einen Herbstbereich) moniert werden.
Harald Schatzl
Spieler: 1-6
Alter: 12+
Dauer: 90+
Autoren: Jamey Stegmaier
& Alan Stone
+ Morten Monrad Pedersen
Grafik: Christine Santana
Preis: ca. 60 Euro
Verlag: Feuerland Spiele 2016
Web: www.feuerland-spiele.de
Genre: Worker Placement
Zielgruppe: Experten
Spezial: 1 Spieler
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja
Kommentar:
schöne und stimmungsvolle grafische Gestaltung
hohe Qualität des Spielmaterials
variable Rundenanzahl und
spielerzahlabhängige Spieldauer
sehr gut (auch) zu zweit sowie solo spielbar
in Begleitung von Vielspielern auch für Gelegenheitsspieler
geeignet
Vergleichbar:
Agricola; Lewis & Clark
Andere Ausgaben:
Viticulture, Stonemaier Games
Meine Einschätzung: 6
Harald Schatzl:
Optisch überzeugt „Viticulture“ gleich nach dem Öffnen mit
seinem strahlenden Spielmaterial, auch wenn sich nach Luftzufuhr eine etwas
ungeschickte Farbwahl mit Verwechslungsrisiken (selbst im noch nüchternen
Zustand) zeigt. Der erste Schluck wirkt aufgrund der erdig-klassischen
Spielmechanismen zwar noch eher neutral, am Gaumen überzeugt dann aber die
betont spielerische Note. Hervorzuheben ist der lang anhaltende Abgang bedingt
durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Karten und der Möglichkeit des Ausprobierens
unterschiedlicher Spielweisen; dies bei einer ausgereiften, dennoch nicht zu
übertriebenen Komplexität. Insgesamt jedenfalls eine äußerst befriedigende
Geschmacksfülle mit einer nahezu perfekt harmonisierenden Balance aus Bewährtem
und dem fein eingebundenen Thema, die im Detail mit runder Eleganz zu punkten
vermag.
Zufall (rosa): 2
Taktik (türkis): 3
Strategie (blau): 2
Kreativität (dunkelblau): 0
Wissen (gelb): 0
Gedächtnis (orange): 0
Kommunikation (rot): 0
Interaktion (braun): 1
Geschicklichkeit (grün): 0
Action (dunkelgrün): 0