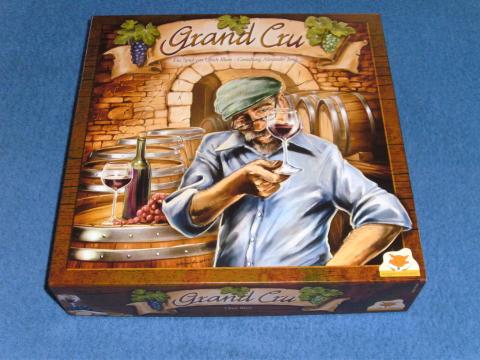
Grand Cru
Die Spieler gründen neue Weingüter an den bestmöglichen Orten und sollen sie erfolgreich führen. Das Spiel verläuft in Jahren mit Ausbau des Weinguts und Jahresende. Ausbau beinhaltet Plättchen erwerben, Direktkauf, Nachfrage erhöhen, Weinlese, Ausbau oder Passen. Jahresende bringt neue Plättchen für die Auslage, Weinfest + Auswertung Weinverkauf und Sonderaktionen, Weinreife, Zinsen + Kredite und Vorbereitung auf das nächste Jahr. Wer als Erster seine Schulden bezahlen kann, beendet das Spiel. Der Wert des Weinguts wird in Geld umgerechnet, eventuelle Kredite werden berücksichtigt. Wer das meiste Geld besitzt, gewinnt.
Dieses Spiel ist in folgenden Sprachen veröffentlicht:
DeutschLudografische Angaben
Verlage:
Autoren:
Illustratoren:
Inventarnummer:
22348
Tags:
ess10
Kategorien:
Setz-/Position, Entwicklung/Aufbau, Experten, komplex
Rezension
Grand Cru
Friends
Alter
Spezial
WEINWÜRFEL & CO
Grand Cru
Nach der Spielanleitung Weinwürfel von
Rebenplättchen lesen
Der Ernteertrag des Weinherbstes 2010 soll wetterbedingt
wenig ergiebig ausgefallen sein. Im Spieleherbst 2010 sind hingegen gleich vier
Wirtschaftsspiele zum Thema Weinbau erschienen: Neben „Grand Cru“ noch „Vinhos“
(Huch & friends), „King´s Vineyard“ (Mayday Games) und „Toscana“ (Aqua
Games). (Als früheres Spiel fällt mir bloß „Vino“ (Goldsieber 1999) ein).
„Grand Cru“ wird vom Verlag mit einem Komplexitätsgrad drei (von vier
„Fuchs-Tatzen“) bewertet. Das trifft unter der Einschränkung zu, dass es auch noch
komplexere Spiele mit fünf oder sechs „Tatzen“ gibt – etwa das Konkurrenz-Spiel
„Vinhos“ dürfte in diese Kategorie fallen. Der Grundmechanismus bei „Grand Cru“
ist eigentlich sehr einfach, geradezu banal: Wir kaufen Weinreben-Plättchen (die
gibt es in fünf Sorten/Farben), welche jede Runde (= ein Spieljahr) einen
Ertrag von jeweils einem Weinwürfel in der entsprechenden Farbe abwerfen. Nach
dem „Ernten“ dieser Weinwürfel – oder vielmehr „Lesen“, wie wir önologisch
gebildeten Winzer wissen – können diese verkauft werden, womit das spielsiegentscheidende
Geld verdient wird. Diverse Sonderfunktionen und -aktionen gestalten den
Spielablauf vielfältiger und reizvoller, sind in der ersten Partie aber etwas
verwirrend.
Ein schönes Spielelement ist zunächst die
variable Anzahl an Spielrunden sowie die variable Anzahl an Aktionen pro Runde.
Den Mitspielern steht zu Spielbeginn jeweils bloß ein Tableau zur Verfügung,
auf dem ein kleiner Weinberg (für die Plättchen) sowie mehrere Fässer (zur
Lagerung der Weinwürfel) abgebildet sind; ansonsten sind wir pleite. Für das
Startkapital muss ein Kredit aufgenommen werden. Das Spiel endet, sobald ein
Mitspieler sein ganzes Fremdkapital zurückgezahlt hat (der deswegen aber nicht
gewonnen haben muss) – oder sobald jemand bankrott gegangen ist, weil er keine
weiteren Kredite zur Zahlung der Zinsen mehr aufnehmen kann. Mit mehr als
(insgesamt) 77 Franc darf man sich nämlich nicht belasten (ja, hier wird
tatsächlich noch – oder schon wieder? – in Franc gerechnet). Der hier
maßgebliche „Zahlenraum 100“ (wie VolksschullehrerInnen zu sagen pflegen)
bietet eine erfreuliche Überschaubarkeit der eigenen Berechnungen. Man muss
sein (ohnehin vom Wein benebeltes) Hirn nicht mit Zahlen mit vielen Nullen
belasten, sondern kann sich ganz auf die gewünschten bzw. möglichen
Spielstrategien konzentrieren. Vordringlich ist jedenfalls der verpflichtende
Zinsendienst jede Runde: 3 bis 13 Franc klingen zwar nach wenig, für unsere
Mikrokredite bedeutet das aber eine Soll-Verzinsung zwischen 17 und 43 % p.a.!
Und der jährliche Verdienst ist lange Zeit äußerst bescheiden. So sieht man
sich in den ersten Runden häufig mit der Entscheidung konfrontiert, dass man
bloß wegen der jährlichen Zinsenlast weitere Kredite aufnehmen muss, welche die
Zinsen im Jahr darauf natürlich noch mehr in die Höhe treiben. Das damit
verbundene Bangen um die eigene wirtschaftliche Existenz erzeugt ein witziges, eigentümlich
sich-getrieben-fühlendes, beinahe schon tunnelblickartiges Spielgefühl.
Der Einkauf der Weinreben- bzw. der Funktionsplättchen
ist auf eine interessante Art gelöst: Entweder ich kaufe ein Plättchen um 7
Franc – was doch eher teuer ist, zumal man ja mehr als ein Plättchen benötigt –
oder ich versuche, einen Spezial-Preis von 1 bis 6 Franc zu bekommen. Damit ist
jedoch das Risiko verbunden, dass ein Mitspieler für das von mir gewünschte
Plättchen einen höheren Preis zu zahlen bereit ist und mir dieses somit
entweder verloren geht oder ich doch mehr als zunächst erhofft bezahlen muss.
Was wie ein weiterer mühsamer und tüftelanfälliger Versteigerungsmechanismus
erscheint, ist tatsächlich eine schöne Innovation: Jedes Anbieten bzw. das weitere
Erhöhen kostet nämlich eine zusätzliche Aktion zu der späteren (und noch dazu
unsicheren) Kauf-Aktion. Vielleicht ist es also doch besser, gleich um 7 Franc
zu kaufen, weil man sich damit (möglicherweise frustrierte) andere Aktionen
erspart? Eine Spielrunde (bzw. ein Spieljahr) kann nämlich – abhängig von der
Strategie der Mitspieler – schon nach (nur) vier Aktionen vorbei sein!
Zuviel Herum-Getue auf dem Einkaufsmarkt verhindert sohin leicht das Ernten und
den Verkauf der Weinwürfel.
Dieser originelle Einkaufs-Mechanismus hat
aber seine Schattenseiten: Zum einen kann in manchen Spielrunden ein
Automatismus ohne Interaktion entstehen, bei dem jeder seine Plättchen um
jeweils 1 Franc kauft. Oder „klug“ spielende Strategen können sich aufgrund
einer weniger rationalen Spielweise willkürlich behandelt vorkommen: Etwa will
Spieler A das rote Weinrebenplättchen um 1 Franc kaufen. Spieler B möchte
weniger gierig erscheinen und will das lila Weinrebenplättchen um 3 Franc
kaufen. Dennoch erhöht Spieler C nicht den Preis der roten Weinrebe, sondern
jenen der blauen. Und Spieler D kümmert das alles wenig, er verkauft lieber
Weinwürfel. Ergebnis: Spieler A erhält billigst eine rote Weinrebe, Spieler B erhält
nichts und hat sogar (entschädigungslos) eine Aktion verloren.
Der Autor ist gegenüber Hausregelvarianten
aber sehr liberal eingestellt. Zunächst hat es im Internet eine heftige
Diskussion darüber gegeben, ob das Spiel wegen der minimal möglichen nur vier
Aktionen pro Runde „kaputt“ sei, weil dadurch ein Mitspieler gezielt die
Strategien seiner Kontrahenten zerstören könne. Dem wurde das Argument entgegen
gehalten, dass die anderen eben mehr auf diesen Mitspieler achten müssten und
diesem gewisse Funktionsplättchen entweder gar nicht oder eben nur zum Preis
von 7 Franc überlassen dürfen. Der Autor hat im Zuge dieses Streites gemeint,
dass man gerne auch mit (mindestens) fünf oder sechs Aktionen pro Runde spielen
könne, wenn einem das besser erscheint. Meine Anregung wiederum war, dass man
quasi als Entschädigung für jedes Überbieten beim Einkauf (bzw. für jedes
Hinauswerfen auf der Versteigerungstabelle) einen Punkt auf der
„Prestigeleiste“ erhält. (Mit den Punkten dieser „Prestigeleiste“ können zum Ende
jeder Runde diverse Sonderaktionen durchgeführt werden – vergleichbar den
vielen „worker placement“-Spielen). Der Autor findet diese Idee „durchaus
interessant“, weder er noch ich haben diese jedoch getestet. (Und gleich noch zwei
weitere Anregungen, die mir sinnvoll erscheinen: Für das Nutzen des Plättchens
„Reiche Ernte“ sollten 2 – und nicht bloß 1 – Franc bezahlt werden müssen. Und
in der Schlussabrechnung sollte die Bewertung der verkaufbaren, bereits reifen
Weinwürfel nicht bloß mit 1 Franc, sondern mit dem jeweils aktuellen,
abgerundeten halben Verkaufspreis erfolgen).
Viel Interaktion kann es auch beim Verkauf
der Weinwürfel geben: Die aktuellen Verkaufspreise für die fünf Farben sind
nämlich einer (gemeinsamen) Kurstabelle zu entnehmen und sinken bei jedem
Verkauf jeweils um 1 Franc (pro Farbe). Eine Preissteigerung wiederum ist ganz
einfach (als eine eigene Aktion) möglich. Von einer Preissteigerung profitiert
primär aber natürlich ein Mitspieler, der unmittelbar nach mir Weinwürfel in
der gleichen Farbe verkaufen kann (und will) – gleichzeitig treibt mir dieser
Mitspieler damit „meinen“ Verkaufspreis wieder in den (Wein-)Keller. Dieser
Mechanismus kann in „unkooperativen“ Spielrunden dazu führen, dass gar niemand
Preissteigerungen vornimmt, um nicht den Mitspielern eine Auflage zu bieten;
was insgesamt zu weniger Verkaufserlösen und zu einer deutlich längeren
Spieldauer führt (sofern dadurch nicht bald jemand bankrott geht).
Positiv ist am
Spielgefühl hervorzuheben, dass die möglichen Aktionen (neben den Aktionen für
den Einkauf noch Ernten, Preissteigerung, Verkauf und spezielle Aktionen
aufgrund von Funktionsplättchen) in beliebiger, selbstgewählter Abfolge zu
kombinieren sind und nur wenig Zeit in Anspruch nehmen, sodass grundsätzlich –
ähnlich wie bei den Rondell-Spielen von Mac Gerdts (siehe WIN Jänner 2011) –
kaum Wartezeiten aufkommen sollten. Auch hier ist es außerdem wesentlich, nicht
bloß sein Kapital effizient einzusetzen, sondern auch die Aktionen (pro Runde)
selbst.
Neben einer möglichen Monotonie im letzten
Spieldrittel fällt negativ zum einen das Spielmaterial auf: Zwar ist
„Weinwürfel“ eine wunderhübsche Wortschöpfung, erinnert optisch aber mehr an
den namenlosen Billigsdorfer-Wein im Tetra-Pack als an noble Burgunder (und
Weintrauben sind bekanntlich rund und nicht eckig). Auch sonst ist alles eher
lieblos und „gerade noch“ zweckmäßig ausgestattet. Zum anderen erscheinen
einige der Spielmechanismen auch nicht wirklich stimmig zum gewählten Thema (etwa
die wucherischen Zinsen für die Mikrokredite, das Unterbieten des
Einkaufspreises für Weinreben, das Lesen der Weintrauben auch schon im Frühling,
die willkürlichen Steigerungen der Verkaufspreise). Hier wäre mehr Humor und
Mut zur Hässlichkeit tatsächlich mehr gewesen: Statt „Grand Cru“ der „Grindige
Heckenklescher“! Dabei würden wir möglichst billig Tetra-Pack-Weine für den Diskontmarkt
produzieren, um zu Spielende hoffentlich aus unserer prekären wirtschaftlichen
Existenz herausgekommen zu sein. Und anstelle der Sonderedition in der Holz-Box
hätte der Verlag als „Luxus-Verpackung“ einen 5-Liter-Tetra-Pack anbieten
sollen.
Es wird ein Weinwürfel sein
Zuletzt ist noch die kleine Erweiterung des
österreichischen Spielemuseums hervorzuheben: Mit den (in ihren Funktionen sehr
stimmigen) Plättchen „Heuriger“ und „Gemischter Satz“ kommt Wiener Lokalkolorit
ins Spiel. Zusätzlich sollten dann natürlich auch die Weinwürfel als Grüner
Veltliner, Riesling, Zweigelt, Blauburger und „lila Jause“ eingewienert werden.
Harald.Schatzl@spielen.at
Spieler : 2 - 5
Alter : ab 12 Jahren
Dauer : ca. 90 +
Autor : Ulrich Blum
Grafik : Alexander Jung
Titel : ident
Preis : ca. € 35
Verlag : eggertspiele 2010
www.eggertspiele.de
Genre : Wirtschaftsspiel
Zielgruppe : mit Freunden
Mechanismen : Kaufen und Nutzen von
Plättchen, Sonderaktionen mit „worker placement“
Kommentar:
variable Rundenzahl, Spieldauer und
Aktionsanzahl
origineller Einkaufs-Mechanismus
leichte Spielthemaverfehlung
teilweise unstimmige Spielmechanismen
eher liebloses bzw. simples Spielmaterial
keine Kurzspielregeln für die Mitspieler
Vergleichbar:
für das „Abernten“ von Plättchen etwa
Puerto Rico, Cuba; für die Sonderaktionen des „Weinfestes“ alle „worker
placement“-Spiele
Meine Bewertung: 5
Harald Schatzl:
Die Spielmechanismen von „Grand Cru“ punkten
mit durchaus origineller Eleganz, einer animierenden Frische und pfeffrigen
Noten, können im Abgang jedoch leider auch zu einem unangenehm bitteren
Nachgeschmack im Spielgefühl führen; das etwas unausgewogene Preis-/Spielmaterialverhältnis
muss man sich erst „schöntrinken“.
Zufall 1
Taktik 3
Strategie__ 2
Kreativität
Wissen_
Gedächtnis 1
Kommunikation 2
Interaktion 3
Geschicklichkeit
Action
Friends
Alter
Spezial
WEINWÜRFEL & CO
Grand Cru
Nach der Spielanleitung Weinwürfel von
Rebenplättchen lesen
Der Ernteertrag des Weinherbstes 2010 soll wetterbedingt
wenig ergiebig ausgefallen sein. Im Spieleherbst 2010 sind hingegen gleich vier
Wirtschaftsspiele zum Thema Weinbau erschienen: Neben „Grand Cru“ noch „Vinhos“
(Huch & friends), „King´s Vineyard“ (Mayday Games) und „Toscana“ (Aqua
Games). (Als früheres Spiel fällt mir bloß „Vino“ (Goldsieber 1999) ein).
„Grand Cru“ wird vom Verlag mit einem Komplexitätsgrad drei (von vier
„Fuchs-Tatzen“) bewertet. Das trifft unter der Einschränkung zu, dass es auch noch
komplexere Spiele mit fünf oder sechs „Tatzen“ gibt – etwa das Konkurrenz-Spiel
„Vinhos“ dürfte in diese Kategorie fallen. Der Grundmechanismus bei „Grand Cru“
ist eigentlich sehr einfach, geradezu banal: Wir kaufen Weinreben-Plättchen (die
gibt es in fünf Sorten/Farben), welche jede Runde (= ein Spieljahr) einen
Ertrag von jeweils einem Weinwürfel in der entsprechenden Farbe abwerfen. Nach
dem „Ernten“ dieser Weinwürfel – oder vielmehr „Lesen“, wie wir önologisch
gebildeten Winzer wissen – können diese verkauft werden, womit das spielsiegentscheidende
Geld verdient wird. Diverse Sonderfunktionen und -aktionen gestalten den
Spielablauf vielfältiger und reizvoller, sind in der ersten Partie aber etwas
verwirrend.
Ein schönes Spielelement ist zunächst die
variable Anzahl an Spielrunden sowie die variable Anzahl an Aktionen pro Runde.
Den Mitspielern steht zu Spielbeginn jeweils bloß ein Tableau zur Verfügung,
auf dem ein kleiner Weinberg (für die Plättchen) sowie mehrere Fässer (zur
Lagerung der Weinwürfel) abgebildet sind; ansonsten sind wir pleite. Für das
Startkapital muss ein Kredit aufgenommen werden. Das Spiel endet, sobald ein
Mitspieler sein ganzes Fremdkapital zurückgezahlt hat (der deswegen aber nicht
gewonnen haben muss) – oder sobald jemand bankrott gegangen ist, weil er keine
weiteren Kredite zur Zahlung der Zinsen mehr aufnehmen kann. Mit mehr als
(insgesamt) 77 Franc darf man sich nämlich nicht belasten (ja, hier wird
tatsächlich noch – oder schon wieder? – in Franc gerechnet). Der hier
maßgebliche „Zahlenraum 100“ (wie VolksschullehrerInnen zu sagen pflegen)
bietet eine erfreuliche Überschaubarkeit der eigenen Berechnungen. Man muss
sein (ohnehin vom Wein benebeltes) Hirn nicht mit Zahlen mit vielen Nullen
belasten, sondern kann sich ganz auf die gewünschten bzw. möglichen
Spielstrategien konzentrieren. Vordringlich ist jedenfalls der verpflichtende
Zinsendienst jede Runde: 3 bis 13 Franc klingen zwar nach wenig, für unsere
Mikrokredite bedeutet das aber eine Soll-Verzinsung zwischen 17 und 43 % p.a.!
Und der jährliche Verdienst ist lange Zeit äußerst bescheiden. So sieht man
sich in den ersten Runden häufig mit der Entscheidung konfrontiert, dass man
bloß wegen der jährlichen Zinsenlast weitere Kredite aufnehmen muss, welche die
Zinsen im Jahr darauf natürlich noch mehr in die Höhe treiben. Das damit
verbundene Bangen um die eigene wirtschaftliche Existenz erzeugt ein witziges, eigentümlich
sich-getrieben-fühlendes, beinahe schon tunnelblickartiges Spielgefühl.
Der Einkauf der Weinreben- bzw. der Funktionsplättchen
ist auf eine interessante Art gelöst: Entweder ich kaufe ein Plättchen um 7
Franc – was doch eher teuer ist, zumal man ja mehr als ein Plättchen benötigt –
oder ich versuche, einen Spezial-Preis von 1 bis 6 Franc zu bekommen. Damit ist
jedoch das Risiko verbunden, dass ein Mitspieler für das von mir gewünschte
Plättchen einen höheren Preis zu zahlen bereit ist und mir dieses somit
entweder verloren geht oder ich doch mehr als zunächst erhofft bezahlen muss.
Was wie ein weiterer mühsamer und tüftelanfälliger Versteigerungsmechanismus
erscheint, ist tatsächlich eine schöne Innovation: Jedes Anbieten bzw. das weitere
Erhöhen kostet nämlich eine zusätzliche Aktion zu der späteren (und noch dazu
unsicheren) Kauf-Aktion. Vielleicht ist es also doch besser, gleich um 7 Franc
zu kaufen, weil man sich damit (möglicherweise frustrierte) andere Aktionen
erspart? Eine Spielrunde (bzw. ein Spieljahr) kann nämlich – abhängig von der
Strategie der Mitspieler – schon nach (nur) vier Aktionen vorbei sein!
Zuviel Herum-Getue auf dem Einkaufsmarkt verhindert sohin leicht das Ernten und
den Verkauf der Weinwürfel.
Dieser originelle Einkaufs-Mechanismus hat
aber seine Schattenseiten: Zum einen kann in manchen Spielrunden ein
Automatismus ohne Interaktion entstehen, bei dem jeder seine Plättchen um
jeweils 1 Franc kauft. Oder „klug“ spielende Strategen können sich aufgrund
einer weniger rationalen Spielweise willkürlich behandelt vorkommen: Etwa will
Spieler A das rote Weinrebenplättchen um 1 Franc kaufen. Spieler B möchte
weniger gierig erscheinen und will das lila Weinrebenplättchen um 3 Franc
kaufen. Dennoch erhöht Spieler C nicht den Preis der roten Weinrebe, sondern
jenen der blauen. Und Spieler D kümmert das alles wenig, er verkauft lieber
Weinwürfel. Ergebnis: Spieler A erhält billigst eine rote Weinrebe, Spieler B erhält
nichts und hat sogar (entschädigungslos) eine Aktion verloren.
Der Autor ist gegenüber Hausregelvarianten
aber sehr liberal eingestellt. Zunächst hat es im Internet eine heftige
Diskussion darüber gegeben, ob das Spiel wegen der minimal möglichen nur vier
Aktionen pro Runde „kaputt“ sei, weil dadurch ein Mitspieler gezielt die
Strategien seiner Kontrahenten zerstören könne. Dem wurde das Argument entgegen
gehalten, dass die anderen eben mehr auf diesen Mitspieler achten müssten und
diesem gewisse Funktionsplättchen entweder gar nicht oder eben nur zum Preis
von 7 Franc überlassen dürfen. Der Autor hat im Zuge dieses Streites gemeint,
dass man gerne auch mit (mindestens) fünf oder sechs Aktionen pro Runde spielen
könne, wenn einem das besser erscheint. Meine Anregung wiederum war, dass man
quasi als Entschädigung für jedes Überbieten beim Einkauf (bzw. für jedes
Hinauswerfen auf der Versteigerungstabelle) einen Punkt auf der
„Prestigeleiste“ erhält. (Mit den Punkten dieser „Prestigeleiste“ können zum Ende
jeder Runde diverse Sonderaktionen durchgeführt werden – vergleichbar den
vielen „worker placement“-Spielen). Der Autor findet diese Idee „durchaus
interessant“, weder er noch ich haben diese jedoch getestet. (Und gleich noch zwei
weitere Anregungen, die mir sinnvoll erscheinen: Für das Nutzen des Plättchens
„Reiche Ernte“ sollten 2 – und nicht bloß 1 – Franc bezahlt werden müssen. Und
in der Schlussabrechnung sollte die Bewertung der verkaufbaren, bereits reifen
Weinwürfel nicht bloß mit 1 Franc, sondern mit dem jeweils aktuellen,
abgerundeten halben Verkaufspreis erfolgen).
Viel Interaktion kann es auch beim Verkauf
der Weinwürfel geben: Die aktuellen Verkaufspreise für die fünf Farben sind
nämlich einer (gemeinsamen) Kurstabelle zu entnehmen und sinken bei jedem
Verkauf jeweils um 1 Franc (pro Farbe). Eine Preissteigerung wiederum ist ganz
einfach (als eine eigene Aktion) möglich. Von einer Preissteigerung profitiert
primär aber natürlich ein Mitspieler, der unmittelbar nach mir Weinwürfel in
der gleichen Farbe verkaufen kann (und will) – gleichzeitig treibt mir dieser
Mitspieler damit „meinen“ Verkaufspreis wieder in den (Wein-)Keller. Dieser
Mechanismus kann in „unkooperativen“ Spielrunden dazu führen, dass gar niemand
Preissteigerungen vornimmt, um nicht den Mitspielern eine Auflage zu bieten;
was insgesamt zu weniger Verkaufserlösen und zu einer deutlich längeren
Spieldauer führt (sofern dadurch nicht bald jemand bankrott geht).
Positiv ist am
Spielgefühl hervorzuheben, dass die möglichen Aktionen (neben den Aktionen für
den Einkauf noch Ernten, Preissteigerung, Verkauf und spezielle Aktionen
aufgrund von Funktionsplättchen) in beliebiger, selbstgewählter Abfolge zu
kombinieren sind und nur wenig Zeit in Anspruch nehmen, sodass grundsätzlich –
ähnlich wie bei den Rondell-Spielen von Mac Gerdts (siehe WIN Jänner 2011) –
kaum Wartezeiten aufkommen sollten. Auch hier ist es außerdem wesentlich, nicht
bloß sein Kapital effizient einzusetzen, sondern auch die Aktionen (pro Runde)
selbst.
Neben einer möglichen Monotonie im letzten
Spieldrittel fällt negativ zum einen das Spielmaterial auf: Zwar ist
„Weinwürfel“ eine wunderhübsche Wortschöpfung, erinnert optisch aber mehr an
den namenlosen Billigsdorfer-Wein im Tetra-Pack als an noble Burgunder (und
Weintrauben sind bekanntlich rund und nicht eckig). Auch sonst ist alles eher
lieblos und „gerade noch“ zweckmäßig ausgestattet. Zum anderen erscheinen
einige der Spielmechanismen auch nicht wirklich stimmig zum gewählten Thema (etwa
die wucherischen Zinsen für die Mikrokredite, das Unterbieten des
Einkaufspreises für Weinreben, das Lesen der Weintrauben auch schon im Frühling,
die willkürlichen Steigerungen der Verkaufspreise). Hier wäre mehr Humor und
Mut zur Hässlichkeit tatsächlich mehr gewesen: Statt „Grand Cru“ der „Grindige
Heckenklescher“! Dabei würden wir möglichst billig Tetra-Pack-Weine für den Diskontmarkt
produzieren, um zu Spielende hoffentlich aus unserer prekären wirtschaftlichen
Existenz herausgekommen zu sein. Und anstelle der Sonderedition in der Holz-Box
hätte der Verlag als „Luxus-Verpackung“ einen 5-Liter-Tetra-Pack anbieten
sollen.
Es wird ein Weinwürfel sein
Zuletzt ist noch die kleine Erweiterung des
österreichischen Spielemuseums hervorzuheben: Mit den (in ihren Funktionen sehr
stimmigen) Plättchen „Heuriger“ und „Gemischter Satz“ kommt Wiener Lokalkolorit
ins Spiel. Zusätzlich sollten dann natürlich auch die Weinwürfel als Grüner
Veltliner, Riesling, Zweigelt, Blauburger und „lila Jause“ eingewienert werden.
Harald.Schatzl@spielen.at
Spieler : 2 - 5
Alter : ab 12 Jahren
Dauer : ca. 90 +
Autor : Ulrich Blum
Grafik : Alexander Jung
Titel : ident
Preis : ca. € 35
Verlag : eggertspiele 2010
www.eggertspiele.de
Genre : Wirtschaftsspiel
Zielgruppe : mit Freunden
Mechanismen : Kaufen und Nutzen von
Plättchen, Sonderaktionen mit „worker placement“
Kommentar:
variable Rundenzahl, Spieldauer und
Aktionsanzahl
origineller Einkaufs-Mechanismus
leichte Spielthemaverfehlung
teilweise unstimmige Spielmechanismen
eher liebloses bzw. simples Spielmaterial
keine Kurzspielregeln für die Mitspieler
Vergleichbar:
für das „Abernten“ von Plättchen etwa
Puerto Rico, Cuba; für die Sonderaktionen des „Weinfestes“ alle „worker
placement“-Spiele
Meine Bewertung: 5
Harald Schatzl:
Die Spielmechanismen von „Grand Cru“ punkten
mit durchaus origineller Eleganz, einer animierenden Frische und pfeffrigen
Noten, können im Abgang jedoch leider auch zu einem unangenehm bitteren
Nachgeschmack im Spielgefühl führen; das etwas unausgewogene Preis-/Spielmaterialverhältnis
muss man sich erst „schöntrinken“.
Zufall 1
Taktik 3
Strategie__ 2
Kreativität
Wissen_
Gedächtnis 1
Kommunikation 2
Interaktion 3
Geschicklichkeit
Action