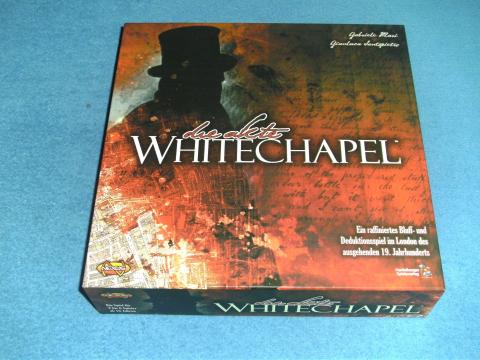
Die Akte Whitechapel
Ein Spieler ist Jack the Ripper und soll 5 Opfer eliminieren, ohne erwischt zu werden. Die anderen Spieler sind Polizisten, die ihn stellen müssen. Jack wählt geheim einen Ort auf dem Plan als Versteck. Immer, wenn er ein neues Opfer gefunden hat, muss er dorthin zurückkehren. Jack kündigt den Tatort an, von dort muss er sein Versteck erreichen. Die Polizisten können in den Straßen nach Spuren suchen oder Verhaftungen vornehmen, sie können sich ohne Hilfsmittel beliebig bewegen. Mit jeder Runde zieht sich das Netz enger zusammen, und viele Spiele enden quasi auf Jacks Türschwelle, so oder so! Kooperation NG International / Heidelberger Spieleverlag
Dieses Spiel ist in folgenden Sprachen veröffentlicht:
DeutschLudografische Angaben
Verlage:
Redaktion:
Autoren:
Illustratoren:
Inventarnummer:
22892
Tags:
nbg11
Kategorien:
Detektiv, Experten, komplex, Denken
Rezension
Martina & Martin Lhotzky, Marcus Steinwender
UNSERE
REZENSION
Friends
Alter 16
Spezial
Die Akte Whitechapel
Morde inmitten der Metropole
Der
Stadtteil Whitechapel, außerhalb der mittelalterlichen Stadtumfassung und
nördlich der Themse gelegen, gehört zum Londoner East End. Spätestens seit der
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts siedelten sich hier vermehrt Zuwanderer an,
die sich in der Hauptstadt der Weltmacht Großbritannien ein besseres Leben
erhofften. Vor allem Iren, aber vermehrt auch Immigranten vom Kontinent,
besonders aus Osteuropa und unter diesen besonders viele Juden aus den damals
zum russischen Zarenreich gehörenden polnischen Gebieten, sowie Engländer auf
dem sozialen Abstieg landeten in dieser von Elend, Armut, Alkoholsucht und der
damit oft einhergehenden Kriminalität geprägten Gegend. Wer hier leben musste,
hatte wenig Aussicht, je wieder zu entkommen. Wer überhaupt Arbeit fand, wenn
auch nur vorübergehend, konnte sich schon zu den Glücklicheren zählen. Viele
Menschen verdingten sich hier um 1880 als Taglöhner. Selbst verglichen mit Wien
zur selben Zeit, wo das Elend der Zugezogenen aus Galizien und vor allem aus
Böhmen auch nicht zu übersehen war und einen gewichtigen Beitrag zum Erstarken
der Sozialdemokratie unter dem Armenarzt Viktor Adler brachte, muss es im East
End trostlos gewesen sein. So trostlos, dass der irische Schriftsteller George
Bernard Shaw, damals knapp über dreißig Jahre alt und als Journalist und
Literaturkritiker tätig, in einem Leserbrief an die Zeitung „The Star“ vom 24.
September 1888 sarkastisch meinte, dem Whitechapel Mörder den Erfolg
zuschreiben zu dürfen, wenigstens für einen Augenblick die Aufmerksamkeit der
bürgerlichen Gesellschaft auf die „soziale Frage“ gelenkt zu haben.
Shaw
bezog sich damit auf eine Reihe von äußerst brutalen Morden an verarmten
Frauen, die meist der Gelegenheitsprostitution nachgingen, um wenigstens einen
Schlafplatz für die Nacht – und Alkohol – bezahlen zu können. Bis Februar 1891
zählte man elf Opfer. Alle diese Taten blieben ungeklärt, ja, in verschiedenen
Abteilungen der Polizei (Metropolitan Police, City Police, Scotland Yard) war
man gar unterschiedlicher Ansicht, ob diese Verbrechen von einem Einzelnen oder
von mehreren Tätern begangen worden waren. Der Akt wurde 1896 geschlossen, aber
die Meinung, dass zumindest fünf der elf Opfer auf die Rechnung eines einzelnen
Serienmörders gingen, sollte sich durchsetzen. Der Spitzname „Jack the Ripper“
stammt aus einem Bekennerschreiben, dessen Authentizität freilich schon 1888
umstritten war (der so genannte „Dear Boss“-Brief vom 27. September jenes
Jahres).
Dieser
Unhold hat nicht nur in Sachbuch, Literatur (zahlreiche Kriminalromane, aber
auch in Frank Wedekinds Drama „Die Büchse der Pandora“), Oper („Lulu“ von Alban
Berg, nach Wedekind), Funk, Film und Fernsehen Einzug gehalten, sondern auch, vermehrt
seit 1988, einhundert Jahre nach den schrecklichen Begebenheiten, Spieleautoren
inspiriert. Man denke nur an „Jack the Ripper“ (Tom Loback et al., 1983),
„Mystery Rummy: Jack the Ripper“ (Mike Fitzgerald, 1998 / auf Deutsch 2009 bei Pegasus)
oder „Mr. Jack“ (Bruno Cathala & Ludovic Maublanc, 2006).
Gabriele
Mari hat im Jahre 2009 mit „Mister X – Flucht durch Europa“ das Spiel des
Jahres 1983, „Scotland Yard“ (damals anonym bei Ravensburger erschienen), von
London auf das Festland versetzt. Immer noch jagen die Mitspielenden einen
geheimnisvollen Verbrecher, der sich beinahe unsichtbar durch die Gegend bewegt
und nur ab und an ein paar Spuren, wie etwa benützte Fahrscheine, hinterlässt. Jetzt
kann man diesem mysteriösen Typen schon in Wiens öffentlichen Verkehrsmitteln
begegnen (2011 etwa wurde die Jagd auf Mr. X am 21. Juni durchgeführt).
Das
Konzept von „Scotland Yard“ hat Mari aber auch auf den Ripper-Fall im Londoner
East End übertragen und nun als „Die Akte Whitechapel“ herausgebracht. Bis zu
fünf Leute in ihren Rollen als Streifenpolizisten des „Herbstes des Schreckens“
(Autumn of Terror) von 1888 folgen der blutigen Spur des Serienmörders. Ihre
Aufgabe ist es, sein Versteck zu finden, noch besser, ihn auf der Flucht
festzunehmen und ihn so an der Begehung weiterer Morde zu hindern. Unabhängig
von der Anzahl der Mitspielenden sind immer fünf Einheiten auf der Jagd nach
dem Killer, sie haben vier Spielabschnitte – jeweils „eine Nacht“ genannt –
Zeit, die Aufgabe zu erfüllen. Auf dem Spielbrett, das Whitechapel mit seinen
verwinkelten Gässchen als vergilbten Stadtplan zeigt, wählt der Ripper geheim
eines der 199 Zahlenfelder als sein Versteck. Dorthin muss er nach jedem
Verbrechen in höchstens neunzehn Zügen zurückkehren. Zuerst hat er fünf Runden
Zeit, ein Opfer auszusuchen. Erst wenn er eine der weißen Holzfiguren, welche
die unglücklichen Frauen darstellen, erkoren und damit ihren Standort als
Tatort und Ausgangspunkt der Jagd festgelegt hat, dürfen die Polizistenfiguren
gezogen werden. Der Ripper bewegt sich auf den Zahlenfeldern, die Polizisten
auf den schwarzen Kästchen zwischen diesen, alle jeweils schwarzen Linien
entlang folgend, fort. Der Ripper notiert, ausgehend vom Tatortfeld die
Nummern, über die er zieht. Die Polizisten dürfen nach jedem Zug (ein bis zwei
Kästchen) den Ripper fragen, ob er schon einmal auf einem der benachbarten
Zahlenfelder war, um so seine Fluchtrichtung und letztendlich sein Versteck zu
ermitteln. Der Ripper muss wahrheitsgemäß antworten. Neben den normalen
Bewegungen kann er pro Nacht auch noch bis zu drei Mal eine Kutsche (zwei
Felder, und außerdem darf er – nur mit dieser Option – an Polizisten
vorbeiziehen) oder bis zu zwei Schleichwege (durch einen Häuserblock hindurch,
also nicht unbedingt entlang der schwarzen Linien des Stadtplans) benutzen. Regelvarianten
ermöglichen dem Ripper auch, die Polizei durch falsche Hinweise zu verwirren. Er
darf Felder blockieren und bis zu drei Karten ausspielen, um Polizistenfiguren
auf dem Feld willkürlich zu versetzen; diese Karten sind nach den
zeitgenössischen Bekennerschreiben benannt und geben dem Spiel seinen Namen in
der Originalfassung: „Lettere da Whitechapel“ / „Letters from Whitechapel“.
Dennoch
hat der Ripper kaum eine Chance. Im Test wurde er immer gefasst, meist noch vor
der dritten Nacht. Das Verhältnis von fünf Polizisten gegenüber einem Ripper,
die diesen bald und relativ leicht einkesseln können (er darf ja ohne Kutsche
nicht über von Polizisten besetzte Felder ziehen und verliert auch, wenn er
nicht am Ende der Nacht in seinem Versteck angelangt ist), ist zu erdrückend. Was
im realen Leben moralisch gerechtfertigt ist, und im London des späten XIX.
Jhdts. vielleicht mehreren Menschen ein grausiges Ende erspart hätte, wird im
Spiel zu einem Ärgernis.
Während
die Spielelemente geradezu exquisit gestaltet sind und zusätzlich ein eigener
Chronikteil in den übersichtlichen und wohlgeordneten Spielregeln die
wichtigsten Punkte der historischen Mordfälle zusammenfasst, mangelt es der
„Akte Whitechapel“ an Möglichkeiten für die Ripper-Seite. Darüber kann auch das
schöne Design nicht hinwegtäuschen. Zusätzlich schlägt das doch eher grausige
Thema negativ zu Buche. Bei „Scotland Yard“ konnte man noch an einen fiktiven
Juwelendieb oder auch Atomspion denken, in diesem Spiel wird man mit jedem
Blick auf das Spielfeld an furchtbare aber reale Gräueltaten erinnert. Deswegen
fällt auch die Altersempfehlung des Verlages mit „ab 16“ (Originalausgabe
übrigens: ab 13) erstaunlich hoch aus für ein Spiel, dessen taktische Anforderungen
ein zwölfjähriges Kind leicht meistern könnte.
Martina
& Martin Lhotzky, Marcus Steinwender
Spieler :
2-6
Alter :
16+
Dauer :
120+
Autor :
Gabriele Mari, Gianluca Santopietro
Grafik :
Gianluca Santopietro
Titel :
Die Akte Whitechapel
Preis :
ca. 40 Euro
Verlag :
Nexus / Heidelberger 2011
Genre :
Deduktionsspiel
Zielgruppe :
Mit Freunden
Version :
de
Regeln :
de en es fr it jp
Text im
Spiel : nein
Kommentar:
ausführliche Spielregel * viel historischer Hintergrund * realistische Grafik *
meist unerwartet rasch zu Ende, schlecht ausbalanciert
Vergleichbar:
Scotland Yard, Fury of Dracula
Andere
Ausgaben: Bei Nexus, Devir, Iello, Hobby Japan
Meine Einschätzung:
3
Statement
Martina, Martin und Marcus: Schön gestaltetes, ausführlich recherchiertes
Spiel, das leider auch die Gewinner nicht sonderlich glücklich macht – ein
großes Ungleichgewicht zugunsten der Ripperjäger.
Zufall 0
Taktik 3
Strategie__ 2
Kreativität 0
Wissen_ 0
Gedächtnis 2
Kommunikation 0
Interaktion 3
Geschicklichkeit 0
Action 0
UNSERE
REZENSION
Friends
Alter 16
Spezial
Die Akte Whitechapel
Morde inmitten der Metropole
Der
Stadtteil Whitechapel, außerhalb der mittelalterlichen Stadtumfassung und
nördlich der Themse gelegen, gehört zum Londoner East End. Spätestens seit der
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts siedelten sich hier vermehrt Zuwanderer an,
die sich in der Hauptstadt der Weltmacht Großbritannien ein besseres Leben
erhofften. Vor allem Iren, aber vermehrt auch Immigranten vom Kontinent,
besonders aus Osteuropa und unter diesen besonders viele Juden aus den damals
zum russischen Zarenreich gehörenden polnischen Gebieten, sowie Engländer auf
dem sozialen Abstieg landeten in dieser von Elend, Armut, Alkoholsucht und der
damit oft einhergehenden Kriminalität geprägten Gegend. Wer hier leben musste,
hatte wenig Aussicht, je wieder zu entkommen. Wer überhaupt Arbeit fand, wenn
auch nur vorübergehend, konnte sich schon zu den Glücklicheren zählen. Viele
Menschen verdingten sich hier um 1880 als Taglöhner. Selbst verglichen mit Wien
zur selben Zeit, wo das Elend der Zugezogenen aus Galizien und vor allem aus
Böhmen auch nicht zu übersehen war und einen gewichtigen Beitrag zum Erstarken
der Sozialdemokratie unter dem Armenarzt Viktor Adler brachte, muss es im East
End trostlos gewesen sein. So trostlos, dass der irische Schriftsteller George
Bernard Shaw, damals knapp über dreißig Jahre alt und als Journalist und
Literaturkritiker tätig, in einem Leserbrief an die Zeitung „The Star“ vom 24.
September 1888 sarkastisch meinte, dem Whitechapel Mörder den Erfolg
zuschreiben zu dürfen, wenigstens für einen Augenblick die Aufmerksamkeit der
bürgerlichen Gesellschaft auf die „soziale Frage“ gelenkt zu haben.
Shaw
bezog sich damit auf eine Reihe von äußerst brutalen Morden an verarmten
Frauen, die meist der Gelegenheitsprostitution nachgingen, um wenigstens einen
Schlafplatz für die Nacht – und Alkohol – bezahlen zu können. Bis Februar 1891
zählte man elf Opfer. Alle diese Taten blieben ungeklärt, ja, in verschiedenen
Abteilungen der Polizei (Metropolitan Police, City Police, Scotland Yard) war
man gar unterschiedlicher Ansicht, ob diese Verbrechen von einem Einzelnen oder
von mehreren Tätern begangen worden waren. Der Akt wurde 1896 geschlossen, aber
die Meinung, dass zumindest fünf der elf Opfer auf die Rechnung eines einzelnen
Serienmörders gingen, sollte sich durchsetzen. Der Spitzname „Jack the Ripper“
stammt aus einem Bekennerschreiben, dessen Authentizität freilich schon 1888
umstritten war (der so genannte „Dear Boss“-Brief vom 27. September jenes
Jahres).
Dieser
Unhold hat nicht nur in Sachbuch, Literatur (zahlreiche Kriminalromane, aber
auch in Frank Wedekinds Drama „Die Büchse der Pandora“), Oper („Lulu“ von Alban
Berg, nach Wedekind), Funk, Film und Fernsehen Einzug gehalten, sondern auch, vermehrt
seit 1988, einhundert Jahre nach den schrecklichen Begebenheiten, Spieleautoren
inspiriert. Man denke nur an „Jack the Ripper“ (Tom Loback et al., 1983),
„Mystery Rummy: Jack the Ripper“ (Mike Fitzgerald, 1998 / auf Deutsch 2009 bei Pegasus)
oder „Mr. Jack“ (Bruno Cathala & Ludovic Maublanc, 2006).
Gabriele
Mari hat im Jahre 2009 mit „Mister X – Flucht durch Europa“ das Spiel des
Jahres 1983, „Scotland Yard“ (damals anonym bei Ravensburger erschienen), von
London auf das Festland versetzt. Immer noch jagen die Mitspielenden einen
geheimnisvollen Verbrecher, der sich beinahe unsichtbar durch die Gegend bewegt
und nur ab und an ein paar Spuren, wie etwa benützte Fahrscheine, hinterlässt. Jetzt
kann man diesem mysteriösen Typen schon in Wiens öffentlichen Verkehrsmitteln
begegnen (2011 etwa wurde die Jagd auf Mr. X am 21. Juni durchgeführt).
Das
Konzept von „Scotland Yard“ hat Mari aber auch auf den Ripper-Fall im Londoner
East End übertragen und nun als „Die Akte Whitechapel“ herausgebracht. Bis zu
fünf Leute in ihren Rollen als Streifenpolizisten des „Herbstes des Schreckens“
(Autumn of Terror) von 1888 folgen der blutigen Spur des Serienmörders. Ihre
Aufgabe ist es, sein Versteck zu finden, noch besser, ihn auf der Flucht
festzunehmen und ihn so an der Begehung weiterer Morde zu hindern. Unabhängig
von der Anzahl der Mitspielenden sind immer fünf Einheiten auf der Jagd nach
dem Killer, sie haben vier Spielabschnitte – jeweils „eine Nacht“ genannt –
Zeit, die Aufgabe zu erfüllen. Auf dem Spielbrett, das Whitechapel mit seinen
verwinkelten Gässchen als vergilbten Stadtplan zeigt, wählt der Ripper geheim
eines der 199 Zahlenfelder als sein Versteck. Dorthin muss er nach jedem
Verbrechen in höchstens neunzehn Zügen zurückkehren. Zuerst hat er fünf Runden
Zeit, ein Opfer auszusuchen. Erst wenn er eine der weißen Holzfiguren, welche
die unglücklichen Frauen darstellen, erkoren und damit ihren Standort als
Tatort und Ausgangspunkt der Jagd festgelegt hat, dürfen die Polizistenfiguren
gezogen werden. Der Ripper bewegt sich auf den Zahlenfeldern, die Polizisten
auf den schwarzen Kästchen zwischen diesen, alle jeweils schwarzen Linien
entlang folgend, fort. Der Ripper notiert, ausgehend vom Tatortfeld die
Nummern, über die er zieht. Die Polizisten dürfen nach jedem Zug (ein bis zwei
Kästchen) den Ripper fragen, ob er schon einmal auf einem der benachbarten
Zahlenfelder war, um so seine Fluchtrichtung und letztendlich sein Versteck zu
ermitteln. Der Ripper muss wahrheitsgemäß antworten. Neben den normalen
Bewegungen kann er pro Nacht auch noch bis zu drei Mal eine Kutsche (zwei
Felder, und außerdem darf er – nur mit dieser Option – an Polizisten
vorbeiziehen) oder bis zu zwei Schleichwege (durch einen Häuserblock hindurch,
also nicht unbedingt entlang der schwarzen Linien des Stadtplans) benutzen. Regelvarianten
ermöglichen dem Ripper auch, die Polizei durch falsche Hinweise zu verwirren. Er
darf Felder blockieren und bis zu drei Karten ausspielen, um Polizistenfiguren
auf dem Feld willkürlich zu versetzen; diese Karten sind nach den
zeitgenössischen Bekennerschreiben benannt und geben dem Spiel seinen Namen in
der Originalfassung: „Lettere da Whitechapel“ / „Letters from Whitechapel“.
Dennoch
hat der Ripper kaum eine Chance. Im Test wurde er immer gefasst, meist noch vor
der dritten Nacht. Das Verhältnis von fünf Polizisten gegenüber einem Ripper,
die diesen bald und relativ leicht einkesseln können (er darf ja ohne Kutsche
nicht über von Polizisten besetzte Felder ziehen und verliert auch, wenn er
nicht am Ende der Nacht in seinem Versteck angelangt ist), ist zu erdrückend. Was
im realen Leben moralisch gerechtfertigt ist, und im London des späten XIX.
Jhdts. vielleicht mehreren Menschen ein grausiges Ende erspart hätte, wird im
Spiel zu einem Ärgernis.
Während
die Spielelemente geradezu exquisit gestaltet sind und zusätzlich ein eigener
Chronikteil in den übersichtlichen und wohlgeordneten Spielregeln die
wichtigsten Punkte der historischen Mordfälle zusammenfasst, mangelt es der
„Akte Whitechapel“ an Möglichkeiten für die Ripper-Seite. Darüber kann auch das
schöne Design nicht hinwegtäuschen. Zusätzlich schlägt das doch eher grausige
Thema negativ zu Buche. Bei „Scotland Yard“ konnte man noch an einen fiktiven
Juwelendieb oder auch Atomspion denken, in diesem Spiel wird man mit jedem
Blick auf das Spielfeld an furchtbare aber reale Gräueltaten erinnert. Deswegen
fällt auch die Altersempfehlung des Verlages mit „ab 16“ (Originalausgabe
übrigens: ab 13) erstaunlich hoch aus für ein Spiel, dessen taktische Anforderungen
ein zwölfjähriges Kind leicht meistern könnte.
Martina
& Martin Lhotzky, Marcus Steinwender
Spieler :
2-6
Alter :
16+
Dauer :
120+
Autor :
Gabriele Mari, Gianluca Santopietro
Grafik :
Gianluca Santopietro
Titel :
Die Akte Whitechapel
Preis :
ca. 40 Euro
Verlag :
Nexus / Heidelberger 2011
Genre :
Deduktionsspiel
Zielgruppe :
Mit Freunden
Version :
de
Regeln :
de en es fr it jp
Text im
Spiel : nein
Kommentar:
ausführliche Spielregel * viel historischer Hintergrund * realistische Grafik *
meist unerwartet rasch zu Ende, schlecht ausbalanciert
Vergleichbar:
Scotland Yard, Fury of Dracula
Andere
Ausgaben: Bei Nexus, Devir, Iello, Hobby Japan
Meine Einschätzung:
3
Statement
Martina, Martin und Marcus: Schön gestaltetes, ausführlich recherchiertes
Spiel, das leider auch die Gewinner nicht sonderlich glücklich macht – ein
großes Ungleichgewicht zugunsten der Ripperjäger.
Zufall 0
Taktik 3
Strategie__ 2
Kreativität 0
Wissen_ 0
Gedächtnis 2
Kommunikation 0
Interaktion 3
Geschicklichkeit 0
Action 0